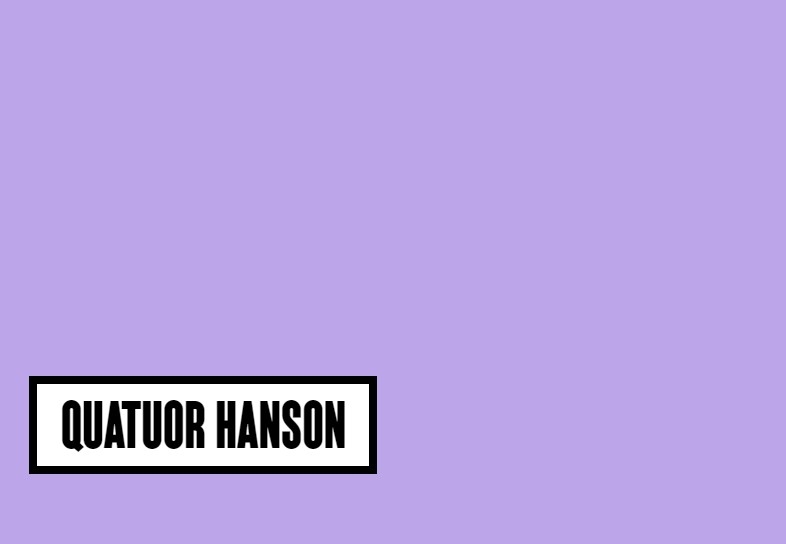1. KAMMERMUSIKKONZERT Quatuor Hanson
Quatuor Hanson
1. Kammermusikkonzert
Das Streichquartett Quatuor Hanson wurde 2013 am Nationalen Konservatorium von Paris (CNSMDP) gegründet, wo es in der Klasse von Jean Sulem studierte. Es wird regelmässig von Hatto Beyerle, Johannes Meissl und dem Quatuor Ébène betreut. Beim 11. Internationalen Wettbewerb für Streichquartett in Lyon im April 2015 wurde es mit einem 3. Preis und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Beim Europäischen Wettbewerb der Musikensembles (der FNAPEC) gewann es ein Stipendium der Akademie der Schönen Künste. Seit 2015 sind die vier MusikerInnen Artists in Residence der Stiftung Singer-Polignac. Mit ihrem grossen Interesse an Quellen- und Urtextforschung haben sie sich ein breites Wissen – besonders über Zeit und Werke Joseph Haydns – und entsprechendes Repertoire erarbeitet. Das Quartett tritt regelmässig in den bekannten Konzerthallen Frankreichs (Oper von Lyon, Salle Cortot, Cité de la Musique u. a.) und in ganz Europa auf.
«Wohlklang im klassischen Sinne»
Einem gewissen «Jean Tost» widmete Joseph Haydn seine Streichquartette op. 64, die 1791 im Wiener Magazine de Musique erschienen. Ob es sich dabei um den Geiger Johann Tost handelte (dem schon die Quartette op. 54 zugeeignet waren) oder um einen Grosskaufmann gleichen Namens, darüber ist viel spekuliert worden. In jedem Fall stellen die «Tost-Quartette» musikgeschichtlich den Übergang von der – eher für den privaten Rahmen komponierten – Hausmusik zur repräsentativen, für ein grösseres Publikum bestimmten Musikform dar. Nicht von ungefähr erklangen einige der Quartette in den grossdimensionierten Aufführungen während Haydns erster Englandreise.
Am bekanntesten ist heute das fünfte Quartett, das sogenannte «Lerchenquartett», kompositorisch eindrucksvoller ist hingegen in mancherlei Hinsicht das hier gespielte zweite Quartett in h-Moll. Es beginnt harmonisch doppeldeutig mit einem Sonatensatz, der auch im weiteren Verlauf immer wieder für Überraschungsmomente sorgt. Möglicherweise hat das zarte Thema des zweiten Satzes einen religiösen Ursprung, in jedem Fall werden die Variationen sehr individuell ausgestaltet. Das Menuett trägt den Kontrast eines schroffen Hauptteils und eines ländlerartigen Trios in sich. Das Rondo-Finale beginnt wieder in der Ausgangstonart, endet aber mit einem strahlenden H-Dur.
Am 24. April 1911 wurde Alban Bergs Streichquartett op. 3 in einem Konzert des Wiener Vereins für Kunst und Kultur aus der Taufe gehoben. Der Wiener Kritik war diese Uraufführung des jungen und bis dato kaum bekannten Schönberg-Schülers nicht mehr wert als eine abfällige Randbemerkung: Das Werk sei schlicht eine «Misshandlung» der Gattung Streichquartett. Erst zwölf Jahre später, im August 1923, stellte sich der Erfolg mit einer Aufführung beim Salzburger Kammermusikfest doch noch ein. «Du kannst Dir’s, nach dem, was Du bisher gehört hast davon, nicht vorstellen. Die sogenannt wildesten u. gewagtesten Stellen waren eitel Wohlklang im klassischen Sinn», berichtet Alban Berg seiner Frau Helene.
Bergs Opus 3 trägt programmatische Züge, denn es stellt Bergs Werben um Helene Nahowski dar, deren Vater die Heirat der beiden hatte verhindern wollen. Hoffnung einerseits und Verzweiflung andererseits stehen sich als Pole gegenüber. Tonaler Kern sind die Töne h-e-a-b-e-g, sinnbildlich für Helene und Alban Berg. Dieser Tonvorrat wird chromatisch ausgefüllt und modifiziert. Damit entsteht eine Tonsprache, die den Übergang zwischen Bergs tonaler und atonaler Schaffensphase bildet. Auch die Form lässt die Konvention hinter sich: Einem rudimentären Sonatensatz folgt nur ein weiterer, formal frei gestalteter Satz.
Nach dem «Liederjahr» 1840 und dem «Symphonienjahr» 1841 wandte sich Robert Schumann 1842 der Kammermusik zu. Dieses «Kammermusikjahr» brachte unter anderem auch die Streichquartette op. 41 hervor. «Quartett in A Moll angefangen», notiert der Komponist am 4. Juni in seinem «Haushaltsbuch». Nur 20 Tage später, an Schumanns 32. Geburtstag, liegt das Werk bereits vollständig vor. Mehrere Aufführungen folgen noch vor Jahresende und finden ein positives Echo. «Von Schumann wurden mir drei Violinquartetten vorgespielt, deren erstes mir ganz ausserordentlich wohl gefiel», schreibt Felix Mendelssohn in einem Brief vom 8. Oktober. Ihm widmete Schumann das Werk später.
In der langsamen Einleitung setzen die Stimmen nacheinander imitatorisch ein, eine Hommage an Johann Sebastian Bach, die schliesslich in einen munteren, von liedhaften Themen getragenen Allegro-Satz mündet. Das kurze, rhythmisch bestimmte Scherzo behält den 6/8-Takt des Kopfsatzes bei, allerdings bis zum Presto gesteigert. Kunstvoll geführte Begleitstimmen und ein leidenschaftli-ches Hauptthema prägen das Adagio, das motivisch mit den vorangegangenen Sätzen verwandt ist. Das Finale folgt der Sonatensatzform und geht nicht ohne einen besonderen Kunstgriff zu Ende: Als kurze Episode erscheint über Bordun-klängen ein volkstümliches Thema, gefolgt von choralartigen Pianissimo-Akkorden. Nach dieser Zäsur wirkt der Abschluss umso eindrucksvoller.