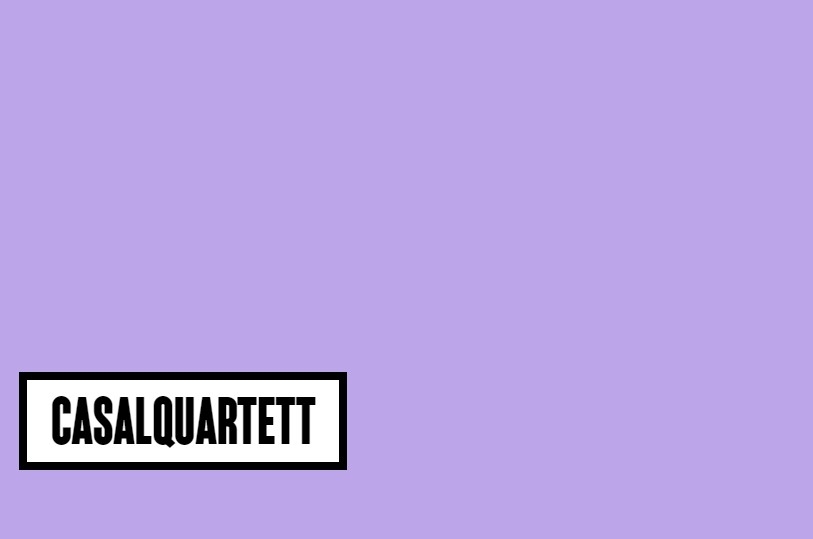6. Kammermusikkonzert casalQuartett
casalQuartett
6. Kammermusikkonzert
Seit seiner Gründung 1996 entwickelte sich das Zürcher casalQuartett in über 1.700 Konzerten in aller Welt zu einem der international renommiertesten Quartette der Schweiz. Seine stilistische Vielfalt und vitale Bühnenpräsenz sind aussergewöhnliche Merkmale. Ausgebildet beim Carmina- Quartett in Zürich, dem Alban-Berg-Quartett in Köln und bei Walter Levin in Basel, kamen wichtige künstlerische Impulse durch die Zusammenarbeit mit Martha Argerich, Clemens Hagen, Patricia Kopatchinskaja, Sol Gabetta, Emma Kirkby, Benjamin Schmid, Maurice Steger, Christoph Prégardien, Fazıl Say, Khatia Buniatishvili, Nuria Rial, Regula Mühlemann, Katja Riemann, Suzanne von Borsody und vielen anderen. Neben der Pflege des Kernrepertoires sind dem cQ die emotionale Nähe zum Publikum, die Einbindung künstlerischer Partner aus verschiedenen Bereichen und die konzeptionelle Ausgestaltung der Programme am wichtigsten. Mitglieder des Ensembles setzen auch in eigenen Festivals und Konzertreihen in der Schweiz und Deutschland diese Vision von innovativem, lebendigem und emotionalem Konzertieren um.
Das Goldene Zeitalter 1750-1800
Sprichwörtlich führen bekanntlich alle Wege nach Rom. Anders ist es in der Musikgeschichte: Hier führen sie nach Wien – zumindest, wenn es um den «klassischen Stil» geht. In dessen Zentrum steht neben der Symphonie und der Sonate das Streichquartett. Wie vielfältig die Entwicklungsstränge dieser kompositorischen Königsdisziplin einst waren, zeigt dieses Konzert.
Es beginnt am Hof des aufgeklärten Kurfürsten Karl Theodor, der seit 1747 in Mannheim residierte und als be-deutender Mäzen der Wissenschaft und der Künste in die Annalen der Geschichte eingegangen ist. Die sogenannte «Mannheimer Schule» bereitete den Boden für die Wiener Klassik. Nicht umsonst verbrachte Wolfgang Amadeus Mozart hier fünf Monate des Jahres 1777 in der (vergeblichen) Hoffnung auf eine Anstellung. Das C-Dur-Quartett von Franz Xaver Richter, der seit 1747 als Komponist, Geiger und Sänger am Mannheimer Hof wirkte, ist das erste einer Reihe von sechs Streichquartetten, die in den späten 1760er-Jahren komponiert wurden. Mussten sich die tiefen Streicher in der Mitte des 18. Jahrhunderts mit einer passiven Rolle als harmonische «Füllstimmen» des vierstimmigen Satzes begnügen, so übernehmen sie in diesem innovativen Werk stellenweise eine Führungsrolle.
Luigi Boccherini stammte aus Lucca, ging aber schon als 25-Jähriger nach Spanien. In Aranjuez trat er als «compositore e virtuoso di camera» in die Dienste des spanischen Infanten Don Luis. Nebenher bezog er ein nicht unbeträchtliches Salär als Kammerkomponist des preussischen Kronprinzen. Sein Opus 2 komponierte Boccherini noch in Italien, vermutlich im zeitlichen Umfeld eines Wien-Aufenthaltes. Alle Sätze bestehen aus zwei jeweils wiederholten Teilen. Das Zusammenspiel der einzelnen Stimmen führt hohe und tiefe Streicher in ganz unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Der langsame Satz hebt mit einer gesanglichen Melodie im Cello an. Das abschliessende Allegro beginnt mit einem dramatischen Unisono, aus dem sich unterschiedliche, teils imitatorisch geführte Passagen ableiten.
Auch Joseph Martin Kraus zog es in die Ferne – allerdings gen Norden: Von Göttingen aus brach er am 26. April 1778 nach Stockholm auf, wo er nach entbehrungsreichen Jahren Kapellmeister des berühmten schwedischen Königs Gustav III. wurde. Wann genau Kraus sein Opus 1 komponierte, ist nicht mit letzter Gewissheit auszumachen. 1784 erschien es in Wien unter dem Titel Six Quatuors Concertants. Im vierten der sechs Quartette zeigt sich Kraus als eigenständiger Schöpfer, der es versteht, starke rhythmische, harmonische und melodische Kontraste zu erschaffen. Besonders in den Ecksätzen entsteht ein spannungsvoller Verlauf. Das Larghetto beeindruckt mit seinen ungewöhnlichen harmonischen Fortschreitungen.
«Ein kurzes Adagio, à 2 Violini, Viola, e Basso, zu einer Fuge, welche schon lange für 2 Klaviere geschrieben habe», notiert Wolfgang Amadeus Mozart am 26. Juni 1788 in seinem eigenhändigen Werkverzeichnis. Ausgangspunkt ist die Klavier-Fuge KV 426, die fünf Jahre zuvor entstanden war, zu einer Zeit, in der Mozart sich intensiv mit der Musik Bachs und Händels auseinandergesetzt hatte. Der punktierte Rhythmus des Adagios knüpft äusserlich tatsächlich an barocke Traditionen an, verbindet sich aber mit einer kühnen und einzigartigen Harmonik, die im kongenialen Fugensatz noch gesteigert wird. Das eingangs vom Cello exponierte Thema ist durch seine chromatischen Zwischen-schritte extrem spannungsgeladen und damit der ideale Ausgangspunkt für den ausdrucksstarken Satz.
«Vor einigen Tagen war ich wieder bei Haydn […]. Bei dieser Gelegenheit spielte er mir auf dem Clavier vor, Violinquartette, die ein Graf Erdödi für 100 Ducaten bei ihm bestellt hat und die erst nach einer gewissen Anzahl von Jahren gedruckt werden dürfen. Diese sind mehr als meisterhaft und voll neuer Gedanken», berichtet der mit Joseph Haydn befreundete schwedische Diplomat Silverstolpe im Juni 1797. Dass sich ein Adliger, in diesem Fall der ungarische Hofkanzler Graf Joseph Erdödy, exklusive Aufführungsrechte an einem unveröffentlichten Werk sicherte, war im ausgehenden 18. Jahrhundert durchaus gängige Praxis. Kontrapunktische Arbeit, aber auch bewusste Einfachheit prägen den munteren Kopfsatz des G-Dur-Quartetts. Das ausdrucksvolle Adagio sostenuto changiert harmonisch zwischen Dur- und Moll-Akkorden. Das Menuett mit seiner engmaschigen Gegenüberstellung von Piano und Fortissimo-Ausbrüchen nimmt die Scherzi Beethovens vorweg. Überraschend beginnt das Finale in Moll; die Wechsel zu Dur im weiteren Satzverlauf verleihen auch diesem Satz reizvolle Überraschungsmomente.